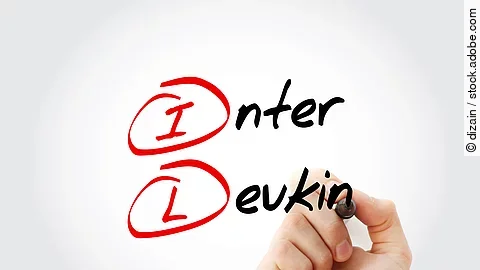Was bislang als gesunde Wahl auf dem Teller galt, rückt nun in ein neues Licht: Aktuelle Forschungsergebnisse werfen Fragen zum Einfluss von Geflügelfleisch auf die Krebsentstehung im Verdauungstrakt auf.
Im Rahmen der Studie machten 4.869 Teilnehmende per Fragebögen Angaben zu ihrem Konsum unterschiedlicher Lebensmittel und Getränken – und eben auch zu verschiedenen Fleischvarianten. Diesen Fleischkonsum teilten die Studienautoren in verschiedene Kategorien ein. Erfasst wurde der wächentliche Verzehr
- von Fleisch insgesamt,
- von rotem Fleisch und
- von Geflügelfleisch.
Deutlich wurde, dass Menschen, die wöchentlich über 300 g Geflügelfleisch verzehrten, ein um 27% erhöhtes Mortalitätsrisiko hatten, verglichen mit den Teilnehmenden, die weniger als 100 g konsumierten.
Männer besonders gefährdet
Im Laufe der Nachbeobachtungszeit verstarben insgesamt 21,1% der Teilnehmenden. 28 der Todesfälle ließen sich auf Leberkrebs, 22 auf Bauchspeicheldrüsenkrebs und 37 auf Darmkrebs zurückführen.
Dabei entfiel der höchste Gesamtfleischkonsum auf die Menschen, die an Magen- und Darmkrebs verstarben. Besonders Männer, die viel Geflügelfleisch konsumierten, hatten im Vergleich zu Männern mit einem geringen Geflügelkonsum ein um das 2,6-Fache erhöhtes Risiko, an Magen-Darm-Krebs zu versterben.
Zur Bestätigung der Ergebnisse seien jedoch weitere Studien erforderlich, wie die Wissenschaftler betonen.
Quelle: Bonfiglio C et al. Nutrients 2025; 17: 1370. DOI: 10.3390/nu17081370