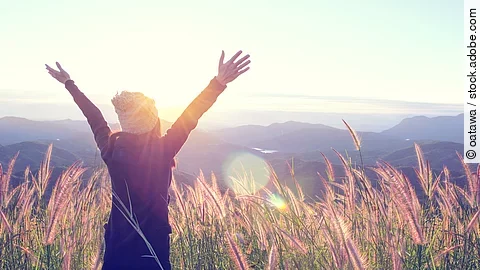Chronische Diarrhö und chronische Obstipation sind weltweit verbreitete gastrointestinale Beschwerden. CED, zu denen Morbus Crohn (CD) und Colitis ulcerosa (UC) gehören, betreffen allein in den USA und Europa über 3 Millionen Menschen, wobei chronische Diarrhö ein häufiges Symptom ist. Angesichts der weiten Verbreitung von Kaffee – Koffein gilt mit einem jährlichen Verbrauch von rund 120.000 Tonnen als die meistkonsumierte, psychoaktive Substanz – besteht starkes Interesse an den Auswirkungen von Koffein auf diese Indikationen. Bisherige Studien lieferten jedoch widersprüchliche Ergebnisse.
Für diese Querschnittsstudie wurden Daten aus der National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) der Jahre 2005–2010 verwendet. NHANES ist ein Programm des National Center for Health Statistics (NCHS), das die Gesundheits- und Ernährungsbedingungen von Kindern und Erwachsenen in den USA durch Screenings, Labortests und Interviews evaluiert. Nach Ausschluss von Personen u.a. mit unvollständigen Daten zum Koffeinkonsum verblieb eine Kohorte von 12.759 geeigneten Probanden.
Der tägliche Koffeinkonsum wurde anhand von zwei 24-Stunden-Ernährungsprotokollen ermittelt. Die Darmgesundheit wurde mittels der Bristol Stool Form Scale (BSFS) durch Selbstauskunft der Teilnehmer beurteilt. Chronische Obstipation wurde definiert als BSFS Typ 1 oder 2, chronische Diarrhö als BSFS Typ 6 oder 7. Eine chronisch entzündliche Darmerkankung wurde als vorhanden angesehen, wenn die Teilnehmer die Frage „Wurde Ihnen jemals von einem Arzt oder anderen Gesundheitsdienstleister gesagt, dass Sie Colitis ulcerosa/Morbus Crohn haben?“ bejahten.
Koffein – die ambivalente Droge
Im vollständig bereinigten Modell zeigte sich eine positive Assoziation zwischen dem Koffeinkonsum und chronischer Diarrhö: Jede zusätzliche Einheit (100 mg) Koffein erhöhte das Risiko für chronische Diarrhö um 4 %. In Sensitivitätsanalysen, bei denen der Koffeinkonsum in Terzile eingeteilt wurde, fand sich jedoch keine signifikante Assoziation.
Beim Zusammenhang zwischen Koffeinkonsum und chronischer Obstipation wurde eine U-förmige nicht lineare Beziehung zwischen Koffeinkonsum und chronischer Obstipation festgestellt mit einem Break-Point bei 2,04 Einheiten (entsprechend 204 mg Koffein). Unterhalb dieses Schwellenwerts war jede Erhöhung der Koffeinaufnahme um eine Einheit (100 mg) mit einer 18%igen Reduktion des Risikos für chronische Obstipation verbunden. Das deutet darauf hin, dass ein moderater Koffeinkonsum bei der Darmpassage helfen kann.
Oberhalb des Break-Points führte jede Erhöhung der Koffeinaufnahme um eine Einheit zu einem 6%igen Anstieg des Risikos für chronische Obstipation. Das legt nahe, dass exzessiver Koffeinkonsum chronische Obstipation verursachen kann. Eine statistisch signifikante Assoziation zwischen Koffeinkonsum und chronisch entzündlichen Darmerlrankungen wurde nicht gefunden.
Was lernen wir daraus?
Die Ergebnisse legen nahe, dass Koffein bei einem Konsum unter 204 mg/Tag eine abführende Wirkung haben kann, während eine Aufnahme über diesem Schwellenwert das Obstipationsrisiko erhöhen könnte. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit Tierstudien, die dosisabhängige Effekte von Koffein auf den Darm zeigten.
Die Mechanismen, durch die Koffein die Darmgewohnheiten beeinflusst, sind noch nicht vollständig geklärt. Hypothesen umfassen
- die Modulation der Darmflora (Förderung nützlicher Bakterien wie Bifidobakterien),
- die Stimulation der distalen Kolonmotorik sowie
- indirekte Wirkungen über neurale Mechanismen oder gastrointestinale Hormone.
Besonders relevant ist die Rolle von Koffein als Adenosin-Rezeptor-Antagonist, der die Melanocortin-Signalweg-Aktivität über die Hemmung von A2A-Rezeptoren verstärkt und so die propulsive Kolonmotilität fördert.
Fazit
Die Studie identifizierte die U-förmige Assoziation bei chronischer Obstipation und analysierte chronische Diarrhö, chronische Obstipation und CED umfassend und separat. Die Subgruppenanalysen, insbesondere die Erkenntnisse bezüglich älterer Erwachsener, liefern spezifische klinische Hinweise. Diese Ergebnisse legen nahe, dass der Einsatz von Koffein in der klinischen Praxis strategisch angegangen werden sollte. Eine individualisierte Koffeinaufnahme, angepasst an den Defäkationsstatus, könnte sinnvoll sein. In Bezug auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen konnten die Autoren allerdings keine signifikante Assoziation mit Koffeinkonsum feststellen, insbesondere da die Anzahl der CED-Patienten in der NHANES-Datenbank für diese Analyse begrenzt war.